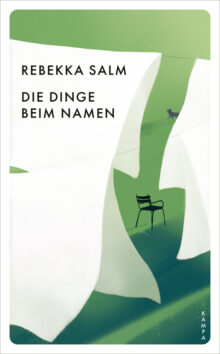
Die Dinge beim Namen
Fügen Sie Ihre Bewertungen hinzu
Besprechung
Moritz Th.
Eine sehr junge Frau, eher noch ein Mädchen, wird an einem «Unterhaltungsabend» des Dorfes von einem etwas älteren Burschen vergewaltigt. Der Täter und das schwangere ...
Berthold H.
„Die Dinge beim Namen“ fängt das Dorfleben von seiner eher skurrilen Seite gekonnt ein. Und dies in einer dramaturgisch durchkomponierten Weise. Indem in jedem der ...
Anmerkungen zu einzelnen Stellen
Kapitel «Vollenweider»
Wir lernen wichtige Posten der (schrumpfenden) Dorf-Infrastruktur kennen, das Feuerwehrmagazin, den Musikverein, den Blumenladen, die auf einen Briefkasten reduzierte Poststelle, die ehemalige Praxis des Dorfarztes. Und wir begegnen dem Metzger, dem Elektriker, der Floristin, oder dem Pöstler. Gekonnt evoziert so die Autorin auf wenigen Seiten einen Dorfkosmos, in den die Einheimischen eingesponnen scheinen. Erzählt wird das erste Kapitel aus der Perspektive eines alleinstehenden Aussenseiters, Vollenweider, der die Geschichten aus dem Dorf aufschreibt. Und offenbar dafür eine deftige Abreibung bekommt. Scheint (mindestens aus diesem Kapitel allein) etwas schwach motiviert. Rauhe Sitten herrschen in diesem Dorf.
«Im Dorf verliess man sich lieber auf Kartoffelwickel und Essigsocken als auf einen fremden Fötzel.»
Der junge Arzt, frisch ab Studium, hatte offenbar einen schweren Stand im Dorf. Lieber keinen Arzt als einen von auswärts, so scheint das Motto der Einheimischen zu lauten.
«Beim Zusammenschluss des unteren und oberen Fringentals, dort, wo die beiden Bachläufe zusammenfliessen, entwickelte sich eine kleine spätrömische Siedlung (…)»
Aus der Geschichte des Dorfes. Nur schwach getarnt, um welches Dorf es sich hier handelt, man vergleiche die Beschreibung aus der Website Bubendorfs ( https://www.bubendorf.swiss/de/gemeinde/portrait/geschichte/index.php? ):
«Beim Zusammenschluss des unteren und des oberen Frenkentals, wo das Bad Bubendorf liegt, entwickelte sich an der Strasse über den Oberen Hauenstein eine kleine spätrömische Siedlung …»
«Wahrheit gründete sich weniger auf Wissen als auf Gewissheit.»
Interessante Aussage. Für die Dorfbewohner zählen historische Tatsachen nicht.
Könnte man sagen, Wissen resultiert aus Erlernen, Gewissheit aus Erleben? Und vielleicht dann, zugespitzt: aus nicht-reflektiertem Erleben?
«Es dauerte eine Weile, bis sie Max und Sandra von ihrem Platz vor der Turnhallentür aus entdeckte.»
Und noch jemand, der am Unterhaltungsabend 1984 beobachtet, wie Max Sandra vergewaltigt: Melanie, die selbst eine Auge auf Max geworfen hatte. Sie legte sich die Vergewaltigung zurecht als Verführung Maxens durch Sandra. – Jetzt begegnen wir ihr bei der Feier zum dreissigsten Hochzeitstag mit ihrem wenig sensiblen Ehemann René.
«(…) dass er am Vally Gefallen gefunden hatte.»
«Der alte Lysser», der verknöcherte Ex-Dorfpolizist, erinnert sich an seine Jugend zurück, und mit einem Mal wird die Sprache mit dem Stabreim samt und weich und mundart-gefärbt, als von Vally die Rede ist, mit den dicken, dunklen Haarzöpfen.
«Einige Latten hingen schief und klapperten einen spöttischen Abzählreim, wenn der Wind durch sie hindurchfuhr.»
Der Garten(zaun) des alten Lyssers hat schon bessere Tage gesehen. Hübscher Satz.
«Das Dorf brauchte jemanden, der danach schaut, dass die Dinge in Ordnung bleiben. (…) Das Glück oder das Unglück eines Einzelnen war dabei von untergeordneter Bedeutung.»
Der junge Fritz Lysser hat einen im Dorf fremden Juden angegriffen, aus Eifersucht, und meint, ihn getötet zu haben, und dass sein Vater ihm half, die Tat zu vertuschen. Er zieht daraus seine eigenartige Ordnungs- Schlussfolgerung, die er sich später als Dorf-Polizist zum Prinzip machte: die Dinge in Ordnung halten heisst sie unter dem Deckel halten, nicht ans Tageslicht kommen lassen. Damit, denkt er, könne er seine Schuld tilgen, die er dann doch zu spüren scheint (p. 71).
Etwas holzschnittartig.
Kapitel «Vally»
Vally ist alt und dement, die Zeiten und die Personen verschwimmen. Alles scheint sich im Kreis zu drehen, wie vor ihren Augen die Schiefertafel mit den Tages-Aktionen des Ladens, in dem Vally tagaus, tagein eine Büchse Russischen Salat kauft, und eine Tube Kondensmilch, für ihren allerdings verstorbenen Ehemann Werner.
Kabinettstück der Konfusion mit Beckettscher Komik. Zugleich erlaubt das Kapitel dem Leser weitere Fäden im Dorfnetz zu spinnen. Der alte Lysser aus dem vorigen Kapitel hatte einst Vally begehrt, wir wechseln aus seiner Perspektive in ihre. Sie hatte dann nicht Fritz Lysser geheiratet, den sie vor vielen Jahrzehnten heimlich bei seinem Angriff auf den Juden Jakob beobachtet hatte, sondern den Metzger Werner Bertschi, der ihr eine bessere Perspektive bieten konnte. Vally ist die Mutter von Sandra, die mit Gründen ein eher distanziertes Verhältnis zur Mutter hat. – Die Verkäuferin im Laden ist ihre Grossnichte Micha, die Vally mit deren Grossmutter, ihrer Schwester Lucy verwechselt.
«Wollten sie (…) überspitzt gesagt auch nur eine Zeitschrift im Dorfladen kaufen, mussten sie ihre Männer um Erlaubnis fragen.»
Die Mittdreissigerin Micha, Single und Verkäuferin im Dorfladen, beneidet die bei ihr einkaufenden verheirateten Altersgenossinnen nicht. – Das Dorf scheint tief im 20. Jahrhundert steckengeblieben zu sein.
«Max war ein Werfer.»
Die Prostituierte Chantal empfängt ihre Kunden in einem Haus am Rand des Dorfes. Einige der männlichen Figuren aus dem Dorf, die wir bereits kennengelernt haben, gehören dazu. Sie unterscheidet zwei Typen: solche, die ihre Kleider nach dem Ausziehen sorgfältig behandeln, und solche, die sie einfach hinwerfen, Falter und Werfer. Die Erzählerin hatte den aktuellen Kunden Chantals nicht namentlich vorgestellt, bis zu diesem effektvoll platzierten Satz. Der gewalttätige Max spielt eine wichtige Rolle in den Dorfgeschichten, aber bislang ist er in der Erzählung im Hintergrund geblieben. Er entpuppt sich als angenehmer Kunde Chantals, mit eskapistischen Phantasien.
Kapitel «Beat»
Ein Traum bricht die Erzählung auf, die etwas von einer erbarmungslosen Mechanik hat, der die Figuren ausgeliefert sind: Ein Anflug von Weichheit, von Sehnsucht, von Bedauern, auch für einmal ein Bezug zur Landschaft um das Dorf, natürlich zu den Kirschbäumen. Und dann ein Moment der Innigkeit zwischen «Opa» (etwas fremd, diese Bezeichnung) Beat und seiner Enkelin Julia.
«Viele träumten davon, das Dorf zu verlassen. Er kannte allerdings niemand, der tatsächlich gegangen war.»
Das Dorf als geschlossene Anstalt, es gibt da keinen Ausgang.
Kapitel «Sandra»
Das letzte Wort im Roman hat Sandra, das Opfer der Vergewaltigung von 1984. War es tatsächlich eine Vergewaltigung gewesen? «Ja», lässt uns Sandra wissen, aber sie weiht uns in einen neuen, überraschenden Aspekt der Geschichte ein. Wir haben begriffen: «Manchmal war eine Geschichte komplexer, als die Geschichten, die man sich darüber erzählte, es erahnen lassen würden.»
Beiläufig erfahren wir auch etwas, was keine der Figuren des Romans weiss, geschickt inszeniert von der Autorin: René und Dorfschul-Lehrer Roland, Sandras Sohn, die sich nachts ausserhalb des Dorfes heimlich treffen, verbindet noch etwas ganz anderes als das Schwulsein, das es im Dorf natürlich geheim zu halten gilt.
«An der 1.-August-Feier vor ein paar Wochen (…) hatten sich die Neuen alle an den gleichen Tisch gesetzt und waren unter sich geblieben.»
Die «Neuen». die Zugezogenen, die Fremden, die in der Stadt arbeiten, halten Distanz zu den Alteingesessenen. Das gilt allerdings auch umgekehrt. Immerhin nehmen die Neuen an der Feier teil.
«Für die eine oder andere Ehefrau war es durchaus schmerzlich festzustellen, dass der Angetraute Haushaltgeld und Körpersäfte in eine andere Frau investierte. Anderseits trugen die Männer auf diese Weise ihre angestauten Gefühle, Lust und Frust, aus dem Dorf hinaus und deponierten sie bei Chantal. Ganz so, wie man Gemüse- und Obstabfälle auf den Kompost im Garten trug, bevor diese im Haus zu gären anfingen und die Luft verpesteten.»
Die Frauen im Dorf wissen, was ihre Männer bei Chantal am Dorfrand treiben. Sandra hat den Verdacht, dass sich Chantal jetzt aber eine Wohnung mitten im Dorf kaufen möchte. Dass aber die Männer vor aller Augen fremdgehen, das ginge zu weit: «Sollten deren Ehefrauen, die in einer Werbepause aus dem Wohnzimmerfenster blicken, mitansehen müssen, wie das Neonherz in Chantals Schlafzimmerfenster für die restliche Dauer des Rosamunde-Pilcher-Films erlosch?» Bitterböse.
«Niemand im Dorf hatte es gelesen, weil niemand im Dorf las.»
Offenbar ist jetzt die Geschichte des Vollenweiders doch als Buch erschienen. Sandra muss sich aber nicht sorgen, dass das Buch, und damit von neuem ihre Vergewaltigung und ihre Heirat mit dem Täter, im Dorf von zum Thema wird.