22 Bahnen
Autor:
Caroline Wahl
Verlag: Dumont
Genre: Belletristik
Erscheinungsjahr: 2023
Weitere bibliographische Angaben
ISBN: 978-3-8321-6803-2
Einbandart: gebunden
Seitenzahl: 208
Sprache: Deutsch
Besprechung
Claire O.
Bewertungen
Besprechung
Besprechung von Buch und Film
(Die deutsche Filmregisseurin Mia Maariel Meyer hat das Buch nach dem Drehbuch von Elena Hell 2025 verfilmt. Caroline Wahl hat ebenfalls am Drehbuch mitgearbeitet. In der Hauptrolle als «Tilda» Luna Wedler)
«22 Bahnen» ist ein Coming-of-Age-Roman von gleich zwei Hauptfiguren. Die 23-jährige Tilda lernt ihre eigenen Wünsche wahrzunehmen und sich auf Neues einzulassen, beruflich wie emotional. Ihre 10-jährige Schwester Ida macht eine enorme Entwicklung durch. Zu Beginn schüchtern und verschreckt, wird sie mutiger und aufgeschlossener, lernt sich durchzusetzen und findet eine Freundin.
Tilda, die Ich-Erzählerin, ist sehr eingespannt: Mathe-Studium, Supermarktkasse, Verantwortung für ihre über alles geliebte kleine Schwester Ida, die alkoholsüchtige Mutter zuhause.
Tilda wusste schon mit 8, dass sie Mathematikerin werden will. Sie liebt die Ordnung in diesem Fachgebiet, die ihr in ihrem Leben fehlt. Zahlen – und zählen – geben ihr Halt und eine Struktur und werden unterschwellig fast zur Manie. Die 22 Bahnen im Titel weisen bereits darauf hin, sie zählt aber auch Sekunden von Gesprächspausen, Wörter in Sätzen oder sie vermerkt, wie oft die Mutter die immer gleichen leeren Versprechungen abgibt.
Tilda arbeitet an der Supermarktkasse, um etwas Geld zum Haushalt beizusteuern. Sie macht sich einen Spass daraus zu erraten, wer die Person ist, deren Einkäufe sie im Supermarkt an der Kasse einscannt – und liegt oft richtig.
Ihre Mutter ist Alkoholikerin und wirft Tilda mehr als einmal vor, dass sie ihr Leben verpfuscht hat, sie ist während des Studiums schwanger geworden. Ihr Vater, genauso wie derjenige der 10-jährigen Halbschwester Ida, ist nicht mehr da. Wenn die Mutter alkoholisiert ist, dann wird sie auch gewalttätig.
Tilda versucht, den Alltag für Ida und sich durchzustrukturieren, aber es bleibt stets die unterschwellige Angst, dass mal wieder etwas aus dem Ruder läuft. Und doch – es gibt diese Momente der Nähe zwischen den Schwestern, auf dem Schulweg oder im Schwimmbad, im Buch und im Film virtuos in Szene gesetzt, die bei aller Verzweiflung die Heldinnen (und die Leserin und den Zuschauer) Mut schöpfen lassen.
Als ihr Mathematik-Professor ihr von einer Promotionsstelle in Berlin erzählt, träumt Tilda zwar davon, will Ida aber nicht alleine quasi wehrlos bei der Mutter lassen. So beschliesst sie, Ida zur Kämpferin zu machen. Das ist im Film etwas verkürzt dargestellt, denn plötzlich ist die kleine Schwester nicht mehr verschüchtert, sondern findet eine Freundin und bieten auch immer wieder der Mutter Paroli.
Im Schwimmbad trifft Tilda auf Viktor, den älteren Bruder von Ivan, der auch 22 Bahnen schwimmt. Viktor sucht erst vergebens Tildas Nähe, schliesslich lässt sie diese aber doch zu, vor allem, da ihr Viktor immer wieder hilft, zum Beispiel auf der Suche nach Ida, die nach einem Wutausbruch der Mutter von zuhause wegrennt. Und auch Ida freundet sich mit Viktor an und bittet ihn um Hilfe, als Tilda mit sehr hohem Fieber im Bett liegt.
Die Rückblenden im Buch und im Film erzählen von den tragischen Ereignissen, die fast 5 Jahre davor passiert sind. Tilda und ihre beste Freundin Marlène hängen mit Leon und Ivan ab. Ivan stammt aus einer russischen Familie und schwärmt davon, mit den kleineren Geschwistern und den Eltern nach Russland zu reisen. Der ältere Bruder Viktor ist bereits selbstständig und reist nicht mit. Am Tag, nachdem Tilda und die anderen mit Ivan gefeiert – und auch Drogen konsumiert – haben, reist die Familie ab und kommt in einem Autounfall ums Leben. Tilda trägt die Sorge, dass Ivan gefahren und sie somit mitschuldig am Tod der Familie ist, 5 Jahre mit sich rum. Erst gegen Ende der Geschichte wird sie von diesem Schuldgefühl befreit, als Viktor ihr sagt, dass Ivan nicht am Steuer sass.
Gegen Schluss sagt Ida zur Mutter, als diese sich nach einem Spitalaufenthalt gegen eine Entziehungskur in einer Klinik entscheidet: "Wir wissen, dass Du es ohne Hilfe nicht schaffst, und wir wissen, dass wir es ohne dich und auch mit dir schaffen»! Das ist eine schöne Unabhängigkeitserklärung der beiden Töchter, die dennoch mit der Mutter verbunden bleiben.
Der Film endet damit, dass Ida Tilda "erlaubt", nach Berlin zu gehen, wo die begabte Studentin die Promotionsstelle antreten kann, und damit auch Ida allein bei der Mutter zurücklassen wird. Dass die Liebesgeschichte zwischen Tilda und Viktor und erst recht die sexuelle Komponente am Ende im Hintergrund bleibt, ist durchaus konsequent.
"Das sollte hier nie eine Liebesgeschichte werden. Das sollte wenn, dann Idas und meine, vor allem Idas Heldinnengeschichte werden, in der sich Ida von Mama befreit. Aber andererseits: Was ist ein Heldenepos ohne Liebe? Was wäre das Nibelungenlied ohne Siegfrid und Kriemhild?"
Dieses Zitat bringt die mitreissende Erzählung auf den Punkt. Der Film nimmt sich gewisse Freiheiten, ist aber in der Essenz ein getreues Abbild des Romans – eine gelungene Verfilmung mit starken Hauptdarstellerinnen.
Mehr zeigen...
(Die deutsche Filmregisseurin Mia Maariel Meyer hat das Buch nach dem Drehbuch von Elena Hell 2025 verfilmt. Caroline Wahl hat ebenfalls am Drehbuch mitgearbeitet. In der Hauptrolle als «Tilda» Luna Wedler)
«22 Bahnen» ist ein Coming-of-Age-Roman von gleich zwei Hauptfiguren. Die 23-jährige Tilda lernt ihre eigenen Wünsche wahrzunehmen und sich auf Neues einzulassen, beruflich wie emotional. Ihre 10-jährige Schwester Ida macht eine enorme Entwicklung durch. Zu Beginn schüchtern und verschreckt, wird sie mutiger und aufgeschlossener, lernt sich durchzusetzen und findet eine Freundin.
Tilda, die Ich-Erzählerin, ist sehr eingespannt: Mathe-Studium, Supermarktkasse, Verantwortung für ihre über alles geliebte kleine Schwester Ida, die alkoholsüchtige Mutter zuhause.
Tilda wusste schon mit 8, dass sie Mathematikerin werden will. Sie liebt die Ordnung in diesem Fachgebiet, die ihr in ihrem Leben fehlt. Zahlen – und zählen – geben ihr Halt und eine Struktur und werden unterschwellig fast zur Manie. Die 22 Bahnen im Titel weisen bereits darauf hin, sie zählt aber auch Sekunden von Gesprächspausen, Wörter in Sätzen oder sie vermerkt, wie oft die Mutter die immer gleichen leeren Versprechungen abgibt.
Tilda arbeitet an der Supermarktkasse, um etwas Geld zum Haushalt beizusteuern. Sie macht sich einen Spass daraus zu erraten, wer die Person ist, deren Einkäufe sie im Supermarkt an der Kasse einscannt – und liegt oft richtig.
Ihre Mutter ist Alkoholikerin und wirft Tilda mehr als einmal vor, dass sie ihr Leben verpfuscht hat, sie ist während des Studiums schwanger geworden. Ihr Vater, genauso wie derjenige der 10-jährigen Halbschwester Ida, ist nicht mehr da. Wenn die Mutter alkoholisiert ist, dann wird sie auch gewalttätig.
Tilda versucht, den Alltag für Ida und sich durchzustrukturieren, aber es bleibt stets die unterschwellige Angst, dass mal wieder etwas aus dem Ruder läuft. Und doch – es gibt diese Momente der Nähe zwischen den Schwestern, auf dem Schulweg oder im Schwimmbad, im Buch und im Film virtuos in Szene gesetzt, die bei aller Verzweiflung die Heldinnen (und die Leserin und den Zuschauer) Mut schöpfen lassen.
Als ihr Mathematik-Professor ihr von einer Promotionsstelle in Berlin erzählt, träumt Tilda zwar davon, will Ida aber nicht alleine quasi wehrlos bei der Mutter lassen. So beschliesst sie, Ida zur Kämpferin zu machen. Das ist im Film etwas verkürzt dargestellt, denn plötzlich ist die kleine Schwester nicht mehr verschüchtert, sondern findet eine Freundin und bieten auch immer wieder der Mutter Paroli.
Im Schwimmbad trifft Tilda auf Viktor, den älteren Bruder von Ivan, der auch 22 Bahnen schwimmt. Viktor sucht erst vergebens Tildas Nähe, schliesslich lässt sie diese aber doch zu, vor allem, da ihr Viktor immer wieder hilft, zum Beispiel auf der Suche nach Ida, die nach einem Wutausbruch der Mutter von zuhause wegrennt. Und auch Ida freundet sich mit Viktor an und bittet ihn um Hilfe, als Tilda mit sehr hohem Fieber im Bett liegt.
Die Rückblenden im Buch und im Film erzählen von den tragischen Ereignissen, die fast 5 Jahre davor passiert sind. Tilda und ihre beste Freundin Marlène hängen mit Leon und Ivan ab. Ivan stammt aus einer russischen Familie und schwärmt davon, mit den kleineren Geschwistern und den Eltern nach Russland zu reisen. Der ältere Bruder Viktor ist bereits selbstständig und reist nicht mit. Am Tag, nachdem Tilda und die anderen mit Ivan gefeiert – und auch Drogen konsumiert – haben, reist die Familie ab und kommt in einem Autounfall ums Leben. Tilda trägt die Sorge, dass Ivan gefahren und sie somit mitschuldig am Tod der Familie ist, 5 Jahre mit sich rum. Erst gegen Ende der Geschichte wird sie von diesem Schuldgefühl befreit, als Viktor ihr sagt, dass Ivan nicht am Steuer sass.
Gegen Schluss sagt Ida zur Mutter, als diese sich nach einem Spitalaufenthalt gegen eine Entziehungskur in einer Klinik entscheidet: "Wir wissen, dass Du es ohne Hilfe nicht schaffst, und wir wissen, dass wir es ohne dich und auch mit dir schaffen»! Das ist eine schöne Unabhängigkeitserklärung der beiden Töchter, die dennoch mit der Mutter verbunden bleiben.
Der Film endet damit, dass Ida Tilda "erlaubt", nach Berlin zu gehen, wo die begabte Studentin die Promotionsstelle antreten kann, und damit auch Ida allein bei der Mutter zurücklassen wird. Dass die Liebesgeschichte zwischen Tilda und Viktor und erst recht die sexuelle Komponente am Ende im Hintergrund bleibt, ist durchaus konsequent.
"Das sollte hier nie eine Liebesgeschichte werden. Das sollte wenn, dann Idas und meine, vor allem Idas Heldinnengeschichte werden, in der sich Ida von Mama befreit. Aber andererseits: Was ist ein Heldenepos ohne Liebe? Was wäre das Nibelungenlied ohne Siegfrid und Kriemhild?"
Dieses Zitat bringt die mitreissende Erzählung auf den Punkt. Der Film nimmt sich gewisse Freiheiten, ist aber in der Essenz ein getreues Abbild des Romans – eine gelungene Verfilmung mit starken Hauptdarstellerinnen.
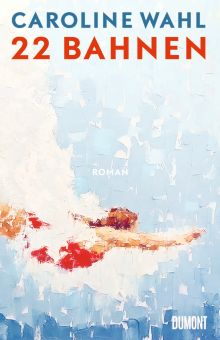


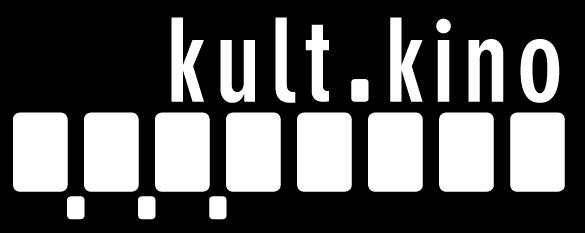



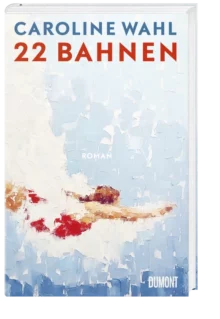
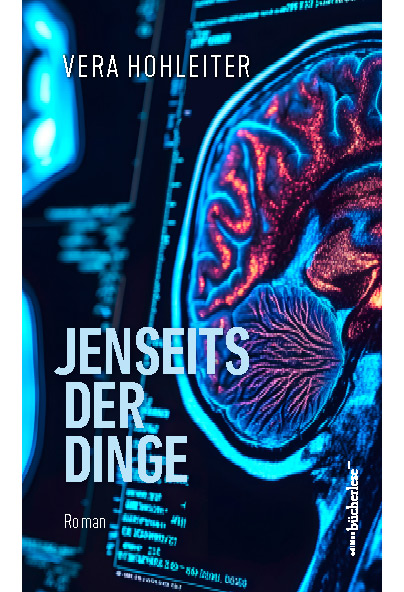
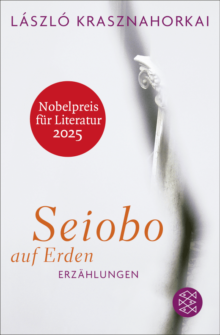
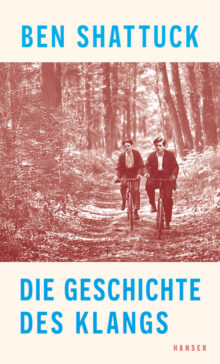
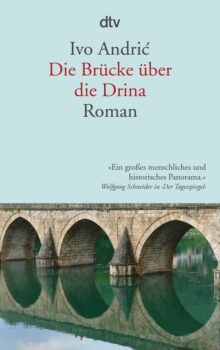
Kommentar
Eine entscheidende Stelle in Goethes «Wahlverwandtschaften»: Ottilie im Kahn auf dem See, nach dem von ihr verschuldeten Ertrinkungstod des kleinen Sohns von Charlotte und Eduard. Das «abgesonderte Schweben» wird noch unterstrichen, indem alles Konkrete, der See, die Parklandschaft aus dem Satz verschwunden sind. Niemand sieht sie, sie sieht niemanden. Bereits hier beginnt sich Ottilies Existenz irdischen Belangen zu entziehen. Aufgerufen wird das Bild einer Figur, die quasi im Nichts schwebt, zwischen Himmel und Erde, die jetzt insgesamt «treulos» und «unzugänglich» erscheint.
Prägnanter lässt sich die grenzenlose Einsamkeit und Verlorenheit einer Figur kaum fassen.