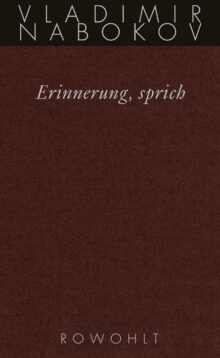
Erinnerung, sprich
Fügen Sie Ihre Bewertungen hinzu
Besprechung
Moritz Th.
Vladimir Nabokovs «Erinnerung, sprich» zeugt vom markanten Einschnitt eines welthistorischen Ereignisses in eine Biographie: Der 18-jährige Jugendliche musste nach der russischen Oktober-Revolution 1917 mit seiner ...
Anmerkungen zu einzelnen Stellen
«Mit einem aufgeregten russischen Kehllaut erhob sich Kuropatkin schwerfällig, und die losen Streichhölzer hüpften auf dem Diwan, als dieser von seinem Gewicht befreit wurde.»
Die grosse Politik hält Einzug in das Arbeitszimmer von Nabokovs Vater im St. Petersburger Familien-Haus. General Kuropatkin erklärt dem fünfjährigen Jungen mit Hilfe von Streichhölzern, die er auf dem Diwan ausbreitet, den Unterschied von ruhigem und stürmischem Meer, als ihn sein Adjutant unterbricht: der General erhielt in diesem Moment die Nachricht, dass er das Oberkommando über die russische Armee im Fernen Osten erhält. Schönes Bild mit den hüpfenden Streichhölzern.
Die Politik spielt im Elternhaus eine grosse Rolle, der Vater ist einer der ersten (liberalen) Parlamentarier in der nach der Revolution neu ins Leben gerufenen Duma. Nach der Februar-Revolution 1917 ist er (meist im Hintergrund) für die Provisorische Regierung tätig. Im Berliner Exil fällt er dann einem politisch motivierten Attentat zum Opfer.
Kapitel 2 (Die Mutter, frühe Kindheit)
Wir erfahren hier mehr zu den Ursprüngen von Nabokovs ausgeprägter Sensibilität und Empfindungsfähigkeit – seine Mutter spielt eine wesentliche Rolle. Sie ermutigte den kleinen Knaben nicht nur, seine «milden Halluzinationen» ernst zu nehmen und sie zu erforschen, sie teilte beispielsweise auch die Buchstaben-Farben-Synästhesie mit ihrem Sohn. Die Phänomene, die Nabokov hier beschreibt, dürften viele Kinder mehr oder minder ausgeprägt wahrnehmen. Für die meisten Eltern und in der Folge dann auch für die Kinder sind die Erscheinungen am Rande des Bewusstseins oder kurz vor dem Einschlafen Trugbilder, denen man keine Beachtung schenkt, oder lästige Nebengeräusche. Nabokov dagegen kultivierte die «Halluzinationen» ein Leben lang, auch wenn «keine mir viel genützt» hat (p. 38), wie er schreibt. Dies möchte man leise bezweifeln. Zum einen hat Nabokov als Schriftsteller aus diesen Empfindungen poetischen Mehrwert geschlagen, und zum anderen scheint auch seine idiosynkratische Metaphysik der Zeit eng mit den Halluzinationen verwoben.
Nabokov portraitiert seine Mutter liebevoll als leicht weltfremdes Wesen voller Urvertrauen, das sie an ihren Sohn weitergeben konnte, mit einem Enthusiasmus für die Farben und Formen des Geistes und der Natur; sie war beispielsweise auch eine begeisterte Pilzsammlerin.
«Die Bekenntnisse eines Synästhetikers müssen sich für Leute, die von festeren Wänden, als die meinen es sind, vor Zugluft und Durchregnen bewahrt werden, langweilig und anmassend anhören.»
Allerdings.
«In den schattigen Tiefen herrschte dann jener eigentümlich boletische Geruch, der einem Russen die Nüstern weitet – eine dunkle, dumpfige, wohltuende Mischung aus feuchtem Moos, satter Erde, verfaulendem Laub.»
Portrait der Mutter als Pilzsucherin in diesem Kapitel 2.3, das die Emotionen der Suche in schönen, ausgesuchten Wendungen wiedergibt.
«Mit einem ständigen Personal von etwa fünfzig Dienstboten, denen weiter keine Fragen gestellt wurden, war unser Haushalt in der Stadt und auf dem Land indessen der Schauplatz eines phantastischen Diebstahlkarussels.»
Vielleicht hat man sich bis anhin noch keine richtige Vorstellung machen können von der Grösse der Nabokovschen Güter – jetzt schon, fünfzig Dienstboten! Dass es auch Schatten in der so schön gezeichneten Welt des alten russischen Adels gab, zeigt dieser Satz auch. Nur vermögen sich die als etwas weltfremd portraitierten Nabokovs mit so profanen Dingen wie Diebstahl nicht auseinandersetzen, und so bleibt das Idyll gewahrt.
«(…) traf Tante Praskowia eines Tages bei einem Abendessen den achtundzwanzig Jahre alten Dr. Anton Tschechow, den sie im Verlauf einer medizinischen Unterhaltung irgendwie kränkte.»
Nabokovs von adliger Herkunft, aber hier werden auch Verbindungen zum geistigen Adel Russlands herbeigeschrieben: ein Bekannter eines Vorfahren hatte Puschkin gekannt, und eine Tante Vladimirs hatte offenbar Tschechov übel beleidigt. Kann nicht jeder von sich sagen! Tschechov nannte in einem Brief vom 22.7.1888 die Tante «einen dicken, verfetteten Klumpen Fleisch», und phantasierte davon sie auszuziehen und grün anzumalen: dann «käme ein Teichfrosch heraus.»
«‹Basile, on vous attend.'»
Der homosexuelle Onkel Ruka hält den acht- oder neunjährigen Vladimir zärtlich auf seinem Schoss – bis Vladimirs Vater den Schwager weg- und wohl auch zur Ordnung ruft. Onkel Ruka vermachte Vladimir später sein beträchtliches Vermögen, allerdings kam Vladimir gar nicht in den Besitz und Genuss davon. Die Revolution kam dazwischen.
«Im Laub liessen Pirole ihre vier hellen Noten hören: dideldi-oh!»
Hmm, scheint ein russischer Dialekt um die Jahrhundertwende zu sein. In der Schweiz im 21. Jahrhundert eher drei Silben zu hören, als Eselsbrücke: «bischelöl».
«(…) kam meine Mutter um des warmen Gemurmels ihres Gutnachkusses willen herauf.»
Variation auf die Proustsche Urszene.
Kapitel 5
Liebevoll-ironisches Portrait der Schweizer Gouvernante «Mademoiselle», die sich in Russland und im Haushalt der Nabokovs zurechtfinden muss.
«In dem grenzenlosen Dunkel um sie herum hält sie das unstete Gefunkel ferner Dorflichter für die gelben Augen von Wölfen.»
Erste russische Eindrücke von Mademoiselle, der neuen (Schweizer) Gouvernante.
«Der Schlaf ist eine geistige Tortur, die ich erniedrigend finde.»
Nabokov, ein Schlafgegner.
«Nichts in der Welt schien mir verlockender, als durch einen Glücktreffer der langen Reihe dieser kleinen Blütenspanner, die andere benannt hatten, irgendeine bemerkenswerte neue Art hinzuzufügen.»
Das Jadgfieber des Lepidopterologen packte den Knaben früh. Angesteckt hatte ihn der Vater, sein Hobby pflegte er intensiv auf dem Landsitz der Familie südlich von St. Petersburg. – Nicht «irgendeine Art», sondern «irgendeine bemerkenswerte Art».
«(…) stiess mit der Radschnauze das kleine weissgetünchte Tor am Ende des Parkes auf (…)»
Vladimir mit dem Fahrrad unterwegs, rund um das Landgut Wyra. Der Autor nimmt uns mit auf die kleine Tour, Schilderung der Route mit für den Fahrradfahrer relevanten Details, vorbei an Wurzeln, über die angenehme Ebenheit einer Brücke.
Es ist eine abendliche Szene, der Velofahrer ist gepackt von einer Unruhe, die ihn hinaustreibt. Mädchen sind mit einem Mal interessant. Der Teenager Vladimir öffnet das Tor zu einer neuen Lebens-Epoche.
«Doch wenigstens entdeckte ich, dass ein Mensch, der Dichter werden will, die Fähigkeit besitzen muss, gleichzeitig an verschiedene Dinge zu denken.»
Nabokovs Poetologie nahm früh Formen an. Als er dieses Gesetz entdeckt, war Vladimir 15 Jahre alt.
Kapitel 12 (Tamara)
Dieses Kapitel ist der Jugendliebe Tamara gewidmet. Die Erinnerung beschwört die erste Begegnung herauf, reglos, wie eine mythologische Figur erscheint das Mädchen dem 16-jährigen Vladimir an einem Julinachmittag im Wald. Die Reglosigkeit, das zeigt sich so gleich, ist aber der Vorbereitung zu einem profanen Bremsenschlag geschuldet, und das Bild, jetzt mit drei Mädchen, gerät wieder in Bewegung.
Die beiden verliebten Teenager streifen durch die Parks der Nabokovschen Anwesen, nur gelegentlich von neugierigen Blicken verfolgt. Vladimir sucht sie auch nach Einbruch der Dunkelheit auf, die Radlampe beleuchtet den Weg. Dann nur noch Rauschen der Linden und das Rieseln der Regenrinne.
Der markante Wechsel nach St. Petersburg, der Verlust der «Waldessicherheit» setzt der jungen Liebe zu. Jetzt wandern die beiden in einem Gefühl der Heimatlosigkeit durch die Stadt, auf der Suche nach einem Zufluchtsort, den sie in einer ganzen Reihe von Museen, in abgelegenen, unpopulären Räumen, finden, die der Autor akribisch aufzählt. Wir erfahren viel von der hauptstädtischen Museumslandschaft, wenig von Tamara. Noch einmal verbringen sie einen Sommer voll Innigkeit zusammen im Süden St. Petersburg, aber dann trennen sich die Wege. Tamara stammt aus einer anderen Gesellschaftsschicht, sie muss arbeiten gehen.
Für den Autor sind dann eine Zeitlang der Verlust der Heimat mit der Oktoberrevolution und der Verlust der Jugendliebe synonym, auch wenn strikt genommen wohl das eine mit dem anderen nicht viel zu tun hatte (p. 330). Der Schluss des Kapitels zeigt uns den 19-jährigen Helden auf der Krim, der ersten Station des Exils, wie sich weisen wird.
«Man muss sich darüber im klaren sein, dass der Kampf bei Schachproblemen nicht eigentlich zwischen Weiss und Schwarz stattfindet, sondern zwischen dem Problemautor und dem hypothetischen Löser (genau wie in einem erstklassigen Roman der Zusammenstoss nicht zwischen den Figuren, sondern zwischen dem Verfasser und der Welt stattfindet), so dass der Wert eines Problems zu einem grossen Teil von der Zahl der Versuche abhängt – täuschende Eröffnungen, falsche Fährten, trügerische Lösungswege, mit Scharfsinn und Liebe entworfen, um den Löser in die Irre zu führen.»
Eristischer Grundzug in Nabokovs Poetologie.