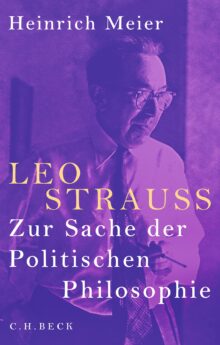
Leo Strauss
Fügen Sie Ihre Bewertungen hinzu
Besprechung
Moritz Th.
Leo Strauss war ein deutscher Philosoph, der unter anderem bei Cassirer, Heidegger und Husserl studiert hatte. 1937 emigrierte er in die USA und war dann ...
Anmerkungen zu einzelnen Stellen
«(…) Philosophie nicht als ein Lehrgebäude oder ein Fach, sondern als eine besondere Form des Lebens zu verstehen sei. In diesem Verständnis stimmt er mit den wahren Philosophen von Platon bis Nietzsche überein.»
Leo Strauss stimmt also überein mit Nietzsche und Platon. Mit der Bezeichnung «wahre Philosophen» bezieht auch Heinrich Meier Position.
Kapitel 1: Das philosophische Leben. The law of reason of «Kuzari»
Aus den Erörterungen Meiers zur Lektüre Strauss von Halewis «Kuzari» lässt sich extrahieren: Der Philosoph ist prinzipiell ein asoziales Wesen, seine Erkenntnisse bleiben zuletzt relativ und können darum nicht verbindend sein. Das Argument für den Glauben ist ein politisches / soziales: ohne das Fundament einer Offenbarungs-Religion kann ein Gemeinwesen nicht bestehen.
Unklar bleibt aber zunächst die Position der Politischen Philosophie. Müsste nach der Darlegung doch ein Oxymoron sein?
«Er erkennt im Kuzari zuallererst das perfekte Sujet für die Einführung des Begriffs des philosophischen Lebens und für die Verhandlung des Vernunftgesetzes.»
Merkwürdige Strategie, die Meier hier Strauss unterstellt. Anhand der Interpretation einer mittelalterlichen Dichtung, die den (jüdischen) Glauben verteidigt, will Leo Strauss seinen Begriff des «philosophischen Lebens» etablieren.
Das Problem dieser Strategie: um mit Autorität über das philosophische Leben zu reden, muss da nicht einer selbst Philosoph sein? Aber der «Kuzari» zeichnet sich durch scharfe Kritik an der Philosophie aus. Ist der Autor Halewi also kein Philosoph, sondern ein Philosophie-Gegner? Aber wie kann ein Gegner glaubwürdig über das philosophische Leben berichten?
Das ist nur dann nicht möglich, wenn man von einer scharfen Trennung von Philosophie und Glauben ausgeht; dies scheint allerdings hier eine Grundannahme zu sein, vgl. auch p. 19/20. Aber selbst wenn man das zugibt: warum soll sich ein Philosoph nicht zum Glauben bekehren können, und dann aus seinem eigenen früheren Leben als Philosoph berichten?
Strauss scheint zu argumentieren, dass ein genuiner Philosoph nicht konvertieren kann. Und wenn er konvertiert, war er kein genuiner Philosoph.
Halewi A und Halewi B
Erörterung zweier Hypothesen:
Halewi A: er ist ein raffinierter, camouflierter Philosoph, der dem Leser anheimstellt, die Gedanken des (meist) abwesenden Philosophen zu denken und so selbst zum Philosophen zu werden.
Strauss selbst räumt ein, dass das unwahrscheinlich ist.
Halewi B: er war ein Philosoph, hat aber zum Glauben gefunden. Nur… dann war er aber gemäss Strauss kein genuiner Philosoph.
«Die Philosophie setzt ein mit der Infragestellung von Autorität und Tradition. Das philosophische Leben beginnt mit der Leugnung einer Verbindlichkeit oder Gehorsamspflicht (…), wonach es kein zurück gibt.»
Radikale Trennung, der Philosoph kann nicht gläubig sein.
«(…) tritt Strauss an die Stelle des Philosophen, der die Szene verlassen hat. Er ist im Unterschied zu Halewis Persona ein politischer Philosoph.»
In Halewis Dichtung gibt es die Position des politischen Philosophen gar nicht. Umso merkwürdiger, dass Strauss dieses Werk nutzt, um das Profil dieser Rolle zu schärfen.
«Die Vernunft wäre, auf sich gestellt, in der Lage zu erkennen, dass keine Gesellschaft ohne Religion bestehen kann, aber sie erwiese sich ausserstande, den Glauben und das Handeln, derer die Gesellschaft bedarf, richtig zu bestimmen.»
Das kann dann nur die geoffenbarte Religion leisten?
«Die Flagge des Naturrechts stellt einen verbindlichen Massstab in Aussicht. Sie verspricht einen Weg zu weisen aus der Orientierungslosigkeit des Relativismus.»
Damit forderte Leo Strauss «die mächtigsten Strömungen in der Philosophie und Politischen Wissenschaften» um 1950 heraus, den Historismus und den Positivismus (p. 57/8).
«‹The more we cultivate reason, the more we cultivate nihilism: the less are we able to be loyal members of the society. The inescapable practical consequences of nihilism is fanatical obscurantism.'»
Aus einer 1970 geschriebenen Einleitung zur Neuauflage von «Natural Right and History». Ob die Kulturrevolution um 1968 in den USA eine Rolle spielte für den verschärften Ton?
«Wenn der Historismus die Behauptung aufrecht erhalten will, alles Denken sei geschichtlich gebunden und folglich geschichtlich überholbar, muss er seine Behauptung von der geschichtlichen Vorläufigkeit oder Hinfälligkeit ausnehmen.»
Meier referiert hier ein Argument von Strauss gegen den Historismus. Nicht ganz überzeugende Durchführung der Argumentation. Was spricht dagegen, dass die Grund-Erkenntnis des Historismus zeitlich begrenzt ist, in der gegenwärtigen Epoche aber Gültigkeit aufweist?
«(…) sondern richtet alle Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit der Offenbarung. Denn die Möglichkeit allein scheint den Ausschlag zu geben und das Patt schliesslich in eine Niederlage der Philosophie zu verwandeln.»
Strauss stellt die Frage, ob die religiöse Offenbarung oder die Philosophie die Oberhand behält, oder ob es ein Patt, ein Unentschieden gibt.
Die Philosophie stosse an Grenzen und könne die Rätsel des Seins nicht lösen: «the need of divine illumnination cannot be denied.» Und weiter: «Philosophy has to grant that revelation is possible.»
Das scheint nun im Gedankengang von Leo Strauss die Niederlage der Philosophie einzuleiten. Warum allerdings die Philosophie die Möglichkeit der Offenbarung einräumen muss, bleibt an dieser Stelle unklar. Und geht aus dem Bedürfnis nach göttlicher Erleuchtung auch schon die Tatsache der Erleuchtung hervor?
In einer Fussnote auf Seite 92 führt Meier aus, dass «Schüler und Schüler von Schülern von Strauss» immer wieder die Meinung geäussert haben, «Strauss sei selbst ein Vertreter des ‹Patts› zwischen Philosophie und Offenbarung.» Das klingt nach esoterischem Geraune. Man hätte sich vom Autor hier etwas mehr Distanz gewünscht, kritische Fragen zur von Strauss vorgelegten Ausgangslage und eine nüchterne Einordnung.
«‹The Old Testament, whose basic premise may be said to be the implict rejection of philosophy, does not know ’nature› (…).'»
Das Alte Testament kennt den Begriff der «Natur» nicht. Bedeutet dies schon die implizite Zurückweisung der Philosophie?
«Die autoritativen Verfügungen, denen das Ganze unterworfen ist, sind stets die Verfügungen eines Teils und dienen zuerst den Interessen dieses Teils. Das gilt nicht nur für eine Monarchie oder eine Oligarchie, sondern auch für die Demokratie.»
Das ist eine Skepsis gegen jede Staatsform, die Partikularinteressen verfolgt. Und soweit hier Meier berichtet, gibt es keine mildernden Umstände für die Demokratie, weil sie vielleicht den Interessen einer grösseren Gruppe dient, oder auch: weil die Macht die Seiten wechseln kann.
Der Sündenfall besteht im «Konventionalismus», die auf das Natur-Recht zu verzichten können glaubt.
«Das beste Regime ist das Regime, in dem die Herrschaft von den ihrer Natur nach Besten ausgeht: die bestmögliche Ausrichtung und Selbstauslegung des Gemeinwesens.»
Strauss relativiert dann alsogleich: Regime sei nicht gleichbedeutend mit Regierung. Das Regime scheint in der Praxis nicht umsetzbar und hat den Status einer Utopie. Zugleich aber soll es «einen Massstab angeben».
Nach dieser Doktrin gibt es ganz offensichtlich aber prinzipiell die Möglichkeit festzustellen, was denn nun das Beste ist, und dafür muss man wohl die unverrückbaren natural rights-Grundsätze aufsuchen.
Es leuchtet ein, dass mit diesem Massstab die Demokratie keine besondere Hochachtung geniesst. Wechselnde Mehrheiten bringen tendenziell die Gefahr mit sich, vom Massstab abzurücken.
Demokratie wäre demnach wohl die typische Erscheinungsform des konventionalistischen, historistischen Denkens, die sich je nach Situation mal in diese oder jene Richtung bewegt.
«An die Stelle der ‹vollkommenen moralischen Ordnung›, die die ‹Klassiker› in der Konzeption des besten Regimes vor Augen stellten, tritt das natürliche Gesetz, das weithin mit der zweiten Tafel des Dekalogs gleichgesetzt wird.»
Religiöse Offenbarung schlägt die Politische Philosophie, die aber in gewisser Weise mit der Berufung auf unverrückbare natural rights den Boden bereitet hat für «the city of god», die dann auf dem «natürlichen Gesetz» (=göttlichem Gesetz?) beruht.
«Wahre Gerechtigkeit verlangt göttliche Herrschaft.»
Klarer Satz.
«Die Politik, das bürgerliche Leben, verlangt die Versöhnung von Weisheit und Zustimmung, von Einsicht und Freiheit, oder, wie er jetzt hinzufügt, ‹einen fundamentalen Kompromiss zwischen Weisheit und Torheit›.»
Das klingt dann doch pragmatisch und öffnet vielleicht auch die Türe für die Demokratie als adäquate Staatsform.
Es gibt Spielraum in den einzelnen politischen Handlungen. «There is a universally valid hierarchy of ends, but there are no universally valid rules of action.» (p. 139). Insofern stellt sich das Naturrecht, oder eben in Straussens Terminologie, natural right, als wandelbar dar.
Aber ganz befriedigend ist das nicht. Die konsistente Lösung kommt dann mit der Offenbarungsreligion und ihren politischen Implikationen, wie sie Thomas von Aquin interpretiert (p.140ff). Wie steht aber Strauss dazu? Er scheint dem Staatsmann eine gewisse Handlungsfähigkeit (=Autonomie?) zuzugestehen, p. 141 («Aristoteles und Strauss (…)»).
Locke vs Hobbes
Locke: «eminent klug», «berühmtester und einflussreichster aller moderner Naturrechtslehrer»
Hobbes: «unklug, schelmisch, bilderstürmerischer Extremist», der für den Abbruch der Linie der Naturrechtslehre verantwortlich ist.
Weiter: Begründer des Liberalismus, Schöpfer des politischen Hedonismus und Atheismus.
Die Religion steht einer Umsetzung der politisch-praktischen Philosophie im Wege (p. 149). Könnte man sagen, dass Hobbes gemäss Strauss die delikate Balance oder das Spannungsfeld von Philosophie, Politischer Philosophie, Politische Praxis und Offenbarungsreligion zerstört hat, indem er keine Distanz von Politischer Philosophie und Politischer Praxis mehr tolerieren wollte?
Leise Distanzierung Meiers von teilweise einseitiger Darstellung Hobbes durch Strauss, p. 143/144.
Kapitel III Philosophie und Offenbarung
Jerusalem and Athens
Leo Strauss versucht zu zeigen, dass eine Konfrontation von Philosophie und Offenbarungsreligion unumgänglich ist. Er steckt den Rahmen ab, er weist die Rollen zu. Wenn die Philosophie zugeben muss, dass die Offenbarung möglich ist, dann ist sie bereits auf verlorenem Posten.
Strauss schickt Sokrates als Philosophen gegen die biblischen Propheten in den Ring.
Heinrich Meier widerspricht im Einzelnen (und in Fussnoten) hin und wieder der Darstellung von Leo Strauss, oder präzisiert sie, insbesondere wenn es um den Bibel-Kritiker Spinoza geht. Man vermisst aber eine übergeordnete Einschätzung von Meier, der sehr nah am Text und an den Grundannahmen von Strauss bleibt, die, vorsichtig gesagt, nicht selbst-evident sind.
«Only philosophy, not art, morality etc. etc., is the alternative to relevation: human guidance or divine guidance- Tertium non datur.»
Auszeichnung der Philosophie vor allen anderen Wissenschaften. Sie ist die einzige Alternative zur göttlichen Offenbarung.
Aber hier wieder die strikte Trennung. Either you got faith or unbelief, there ain’t not neutral ground.
«Strauss – denn von niemand anderem ist die Rede – versucht, das Feuer der Philosophie neu zu entfachen, indem er vermittels historischer Untersuchungen freilegt, was die Philosophie ursprünglich ausmacht, was ihre brennende und versehrende Frage ist, worin sie ihren Grund hat.»
Die Entdeckung der Natur durch die Philosophie bedeutet, dass die Philosophie «radikal atheistisch» ist. Gott muss sich jetzt an der Natur beweisen lassen. Die Philosophie arbeitet also grundlegend mit der Hypothese, dass es keinen Gott gibt.
Strauss führt einen doppelten Kampf: er versucht die Philosophen zu überzeugen, dass die Auseinandersetzung mit der Offenbarungsreligion unumgänglich ist, und er versucht die Theologen zu überzeugen, sich mit der Philosophie auseinanderzusetzen. Beide Seiten scheinen Mitte des 20. Jahrhunderts nicht sonderlich interessiert…
Aufgabe der Philosophie ist es nicht, Theolog(i)en zu widerlegen, sondern die Möglichkeit der Offenbarung.
Zuvor Erläuterung, warum Offenbarung und Wunderglauben eng zusammenhängen.
«Das göttliche Gesetz der Offenbarung gibt eine Antwort auf die inneren Widersprüche des göttlichen Gesetzes des Mythos. Das Eine Göttliche Gesetz des Einen Gottes duldet keine politische, religiöse oder moralische Instanz, die von seiner Herrschaft ausgenommen wäre.»
Göttliche Gesetze des Mythos: verschiedene Götter, einander widersprechende Gesetze, ohne konsistente Moral. Der Mensch aber, als soziales und bedürftiges Wesen, scheint angewiesen auf Klarheit, um in der Polis zu leben. Darum ist die Offenbarung, die keine Herleitung kennt und keinen Widerspruch duldet, die Antwort. Die Quelle «muss ein omnipotenter Gott» sein.
Die Offenbarung ist ein einmaliges Ereignis, definitiv, abgeschlossen. Dahinter kann man nicht zurück.
Interessant ist der Ausgangspunkt der Bedürftigkeit, «der Natur» des Menschen.
«Wenn die Philosophie sich angemessen verstehen will, muss sie sich mit dem politischen Gemeinwesen befassen, in dem ihr Weg beginnt.»
Die Philosophie ist dann Philosophie, wenn sie grundsätzliche Frage nach der Autorität stellt. Sie ist also immer politisch.
Das ist ein interessanter, produktiver Ansatz.
«Der Kommunismus scheint ein Preis zu sein, den die gute Stadt dafür zu entrichten hat, dass die Stadt auf die Proklamation göttlicher Sanktionen entrichtet (…)»
Denunziation «der guten Stadt» Platons, die «das Problem der Gerechtigkeit nicht gelöst hat» (p. 337).
«Eine Verhandlung, die dem politischen Leben gerecht zu werden versucht, ‹cannot start from seeing the city as the Cave but it must start from seeing the city as a world, a the highest in the world; it must start form seeing man as completely immersed in political life: ‹the present war is the greatest war›.'»
Thukydides ist für Strauss wichtiger als Aristoteles, wenn es um die Definition des politischen Lebens geht, weil er immer auch die Aussenpolitik mitbedenkt.
Aristoteles und Platon bleiben im Abstrakten stecken, wenn sie den idealen Staat definieren.
«Dir vorphilosophische Stadt folgt dem Glauben, dass die politisch-theologische Einheit nicht von unten begründet wird, sondern von oben gestiftet ist.»
Aristoteles und Platon stehen hier für die philosophische Stadt, Thukydides für die vorphilosophische Stadt.
Die Implikationen sind weit, bis hin zur Skepsis gegenüber der Demokratie, die eine Einheit «von unten» zu begründen versucht. Der Versuch, so eine gerechte Stadt zu schaffen, mündet in den Aporien der Herrschaft der Philosophen-Könige.
«was mit Sokrates seinen Anfang nahm»
Aufklärung, irdisches Glück im universalen Staat, Liberalismus, Demokratie, Sozialismus.
Alles Übel der Welt, mit anderen Worten.
Nietzsche paraphrasierend.
Meiers kritische Sicht auf den «gewöhnlichen Aufklärer»
In Aristophanes «Die Wolken» zeigt sich, dass Strepsiades nicht in der Lage ist, mit den Erkenntnissen umzugehen, die Sokrates ihm vermittelt, zB dass Zeus gar nicht existiere.
Meier nimmt das in der Fussnote 35 zum Anlass zu fragen, ob Sokrates der Illusion des «gewöhnlichen Aufklärers» unterliege, dass «die Natur des Gegenübers gleichsam nach Belieben geformt werden könne».
«Die Forderung Eine Welt, Eine Herrschaft, Ein Friede liegt in der Fluchtlinie des universalen Anspruchs, den die Philosophie erhebt.»
Interpretation von «Die Vögel» von Aristophanes. – Hier wieder implizit der Vorwurf des Totalitarismus. Die Philosophie, man könnte auch sagen: die Aufklärung, schätzt die Natur des Menschen nicht richtig ein. Um dennoch den Frieden zu erreichen, muss ein «Weltstaat» errichtet werden, der die Natur des Menschen in Schach zu halten vermag. – Was ist die Alternative der Offenbarungsreligion?
«Aristophanes zeigt keine atheistische Stadt. Dagegen stellt er den Zuschauern der Thesmophoriazusen vor Augen, dass die Götter ihr Sein dem Nomos schulden, den sie zu schützen haben.»
Die Argumentation könnte etwa wie folgt aussehen: Die nomoi sind die Basis der Polis. Wenn aber die nomoi menschengemacht, Konvention sind, sind sie nicht unantastbar und erodieren, und mit ihnen die Polis. Nur die Götter, die ihre Daseinsberechtigung genau dieser Funktion verdanken, können die Nomoi schützen. – Was aber sind das für Götter, die nicht unergründlich sind?
«Strauss› Intention trifft sich mit Aristophanes Intention in der Kritik der Ekklesiazusen.»
Die Hässlichkeit der Komödie reflektiert die Hässlichkeit der Idee der Protagonistin Praxagora: in einer Gesellschaft, die keine Ungleichheit toleriert, müssen junge Männer mit alten, unattraktiven Frauen schlafen. Kein politisches und kein philosophisches Leben ist möglich. Das Argument gegen den Kommunismus ist auch ein ästhetisches.