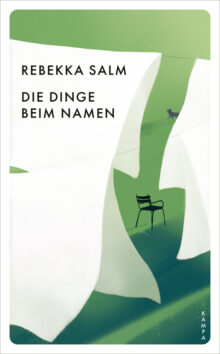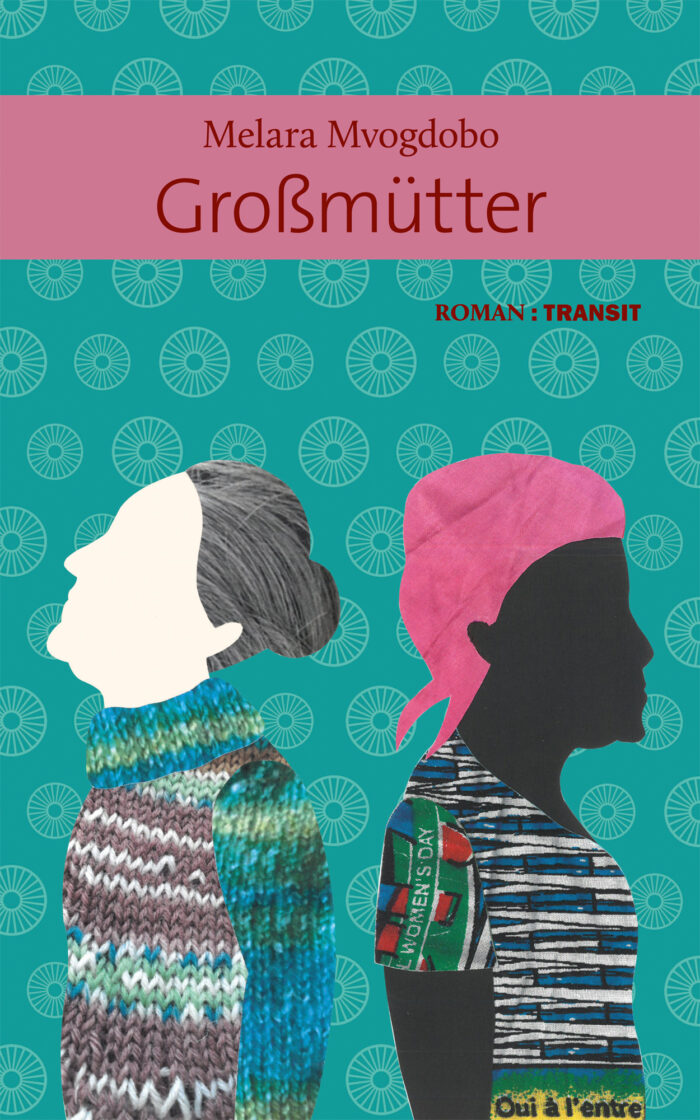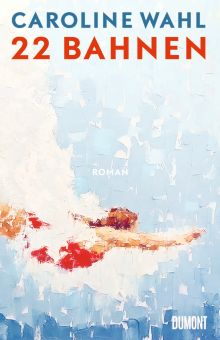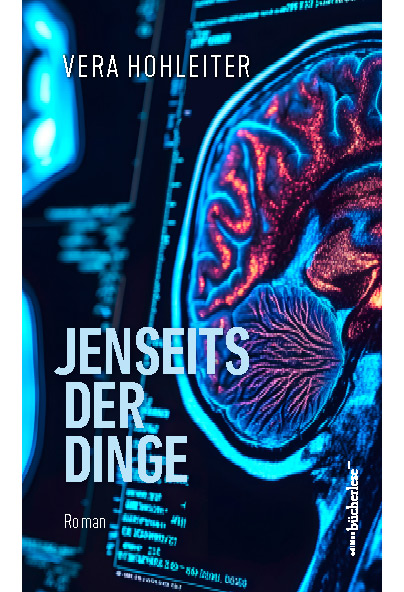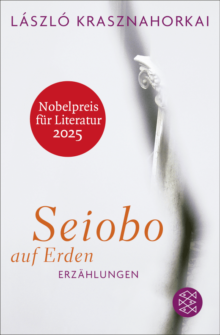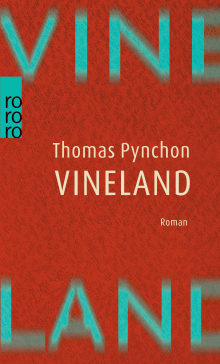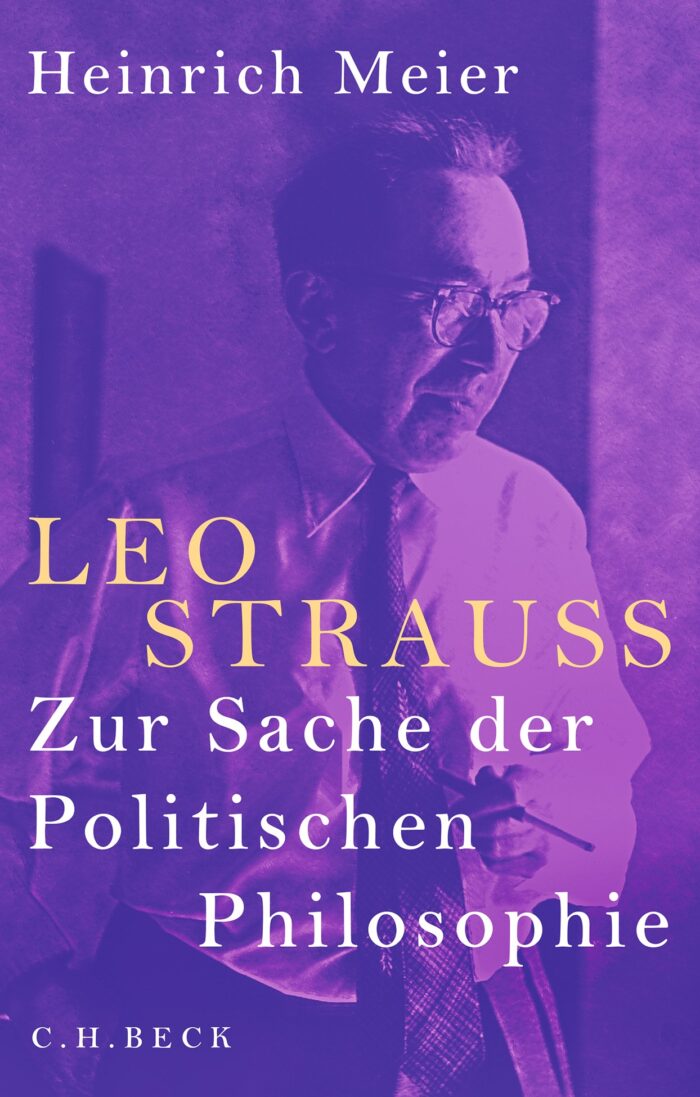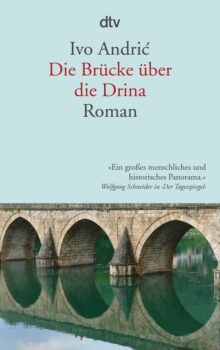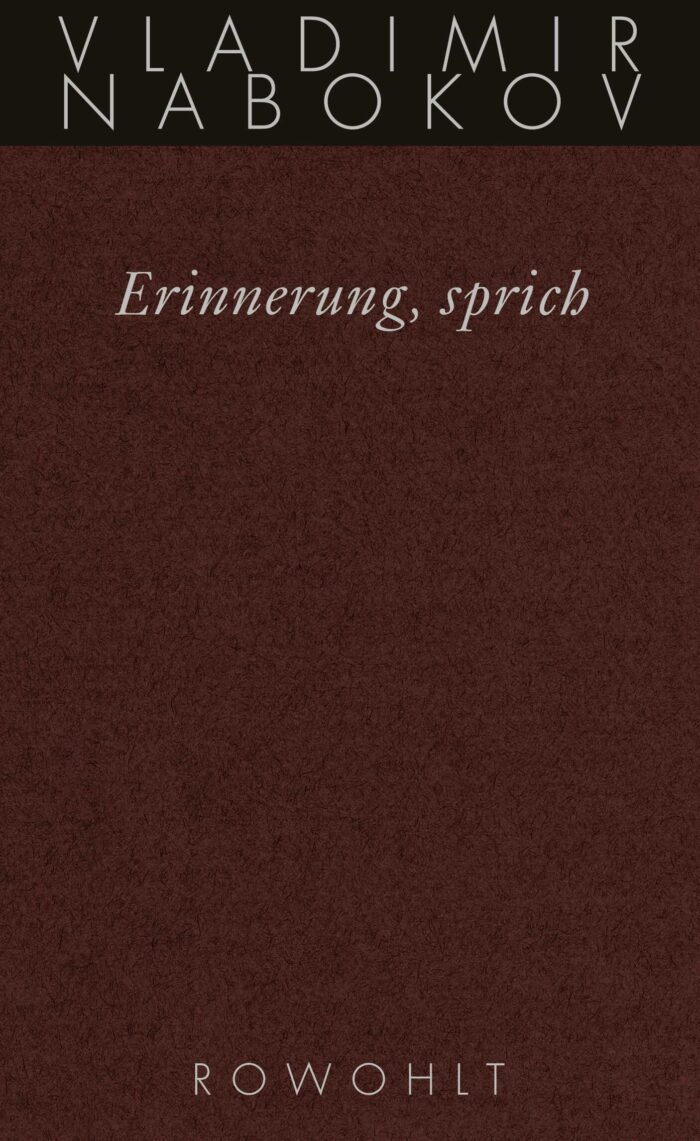Bewertungen
Besprechung
Wir blicken Jahrzehnte später aus verschiedenen Perspektiven zurück auf diese Geschichte des Jahres 1984. Immer wenn wir meinen, wir haben verstanden, was sich damals ereignet hat, lernen wir im nächsten Kapitel neue Details kennen, die die Erzählung mit einer etwas anderen Bedeutung aufladen. Ein Dorf-Prinzip scheint zu sein: Jemand beobachtet immer, und manchmal wird auch der Beobachter beim Beobachten beobachtet. Es bleibt nichts verborgen.
Kennen wir am Ende des Romans die ganze Wahrheit? Welchen Aspekt würde der Täter, der schöne Max, in den damals die eine oder andere junge Dorf-Frau verliebt war, zu der Geschichte hinzufügen?
Er gehört nicht zu den sechs Männern, denen im Roman ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Sandra, das Opfer und seine Ehefrau, ist dagegen eine der sechs weiblichen Figuren, die porträtiert werden. Alle wohnen im Dorf und sind dort fest verwurzelt. Oder sollte man sagen: Sie sind dort gefangen? Beat, der Dorf-Pöstler, sinniert: «Viele träumten davon, das Dorf zu verlassen. Er kannte allerdings niemand, der tatsächlich gegangen war.» Es ist ein Dorf, in dem über den Miststock geheiratet wird, und «fremde Fötzel» ausgegrenzt werden. In jedem Haus wohnt ein Unglück, Metzger Tschudin wird von seiner Frau verprügelt, Melanies Mann René ist ein unsensibler Klotz (und heimlich schwul), Sprach- und Trostlosigkeit dominieren nicht nur die Ehe von Sandra und Max. Die Single-Frau Micha, Verkäuferin im Dorfladen, entgeht dem Schicksal ihrer verheirateten Altersgenossinnen, ist aber mit den One-Night-Stands, die sie jeweils nach dem Wochenend-Ausgang aus der Stadt anschleppt, auch nicht glücklich.
Am Ausgang des Dorfes wohnt die Prostituierte Chantal, aus Osteuropa zugewandert, und dort am Rand geduldet, die Männer des Dorfes «deponieren» bei Chantal «Lust und Frust», «ganz so, wie man Gemüse- und Obstabfälle auf den Kompost im Garten trug, bevor diese im Haus zu gären anfingen und die Luft verpesteten.»
Es ist ein eher düsteres Bild, das Rebekka Salm von diesem Dorf zeichnet. Es gibt wenige Momente der Freude, der Entspannung – am ehesten noch im Kapitel, das den (ansonsten nicht grad sympathisch gezeichneten) Beat als Grossvater im innigen Zwiegespräch mit der Enkelin Julia zeigt. Die Landschaft rund um das Dorf, die Kirschbäume und Eichenhaine, scheinen auch kaum Geborgenheit oder ein Heimatgefühl zu vermitteln. Die Dörfler sind tief in ihre Familiengeschichten verstrickt, man kennt sich und weiss um die Geheimnisse des anderen, spricht sie aber nicht aus. Allerdings gibt es einen Aussenseiter im Dorf, Vollenweider, der die Geschichten aufschreibt und sie veröffentlichen will, wofür er Prügel einsteckt. Am Ende scheint er es doch geschafft zu haben, das Buch bei einem Verlag unterzubringen, nachdem das Manuskript vom Pöstler zunächst abgefangen worden war – wir sind ja auch längst im 21. Jahrhundert mit Internet und Email angelangt, was man im Roman gelegentlich vergessen kann. Droht nun das Buch mit der unschönen Geschichte von Max und Sandra doch noch zum öffentlichen Gesprächsthema zu werden? Die Gefahr ist gering: «Niemand im Dorf hatte es gelesen, weil niemand im Dorf las.» Mit dieser Zuspitzung macht die Autorin die Kommunikationslosigkeit der Dorf-Figuren zu einer absoluten, sie schliesst den Mikrokosmos Dorf hermetisch ab. Zugleich bewirken solche Zuspitzungen aber auch, dass die Figuren und ihre Handlungen auf ein bestimmtes Muster hin entworfen scheinen und zuweilen etwas arg schematisch wirken.
Es ist – etwa an den Flurnamen – deutlich zu erkennen, welcher Ort Vorbild für das namenlose Roman-Dorf war: Bubendorf im Kanton Baselland. Die Autorin nutzt auch schön dosiert ortstypische Dialektausdrücke, vom Tscholi über den Duubel bis zur gägsigen Stimme. Diese Verortung wird dem lesenswerten, zuweilen auch mit provokativen Sätzen zum Nachdenken anregenden Buch bestimmt ein paar zusätzliche Leserinnen und Leser in den beiden Frenkentälern verschaffen.