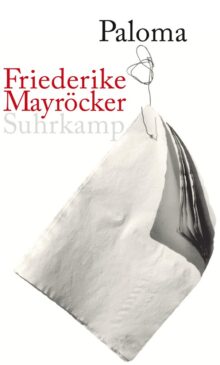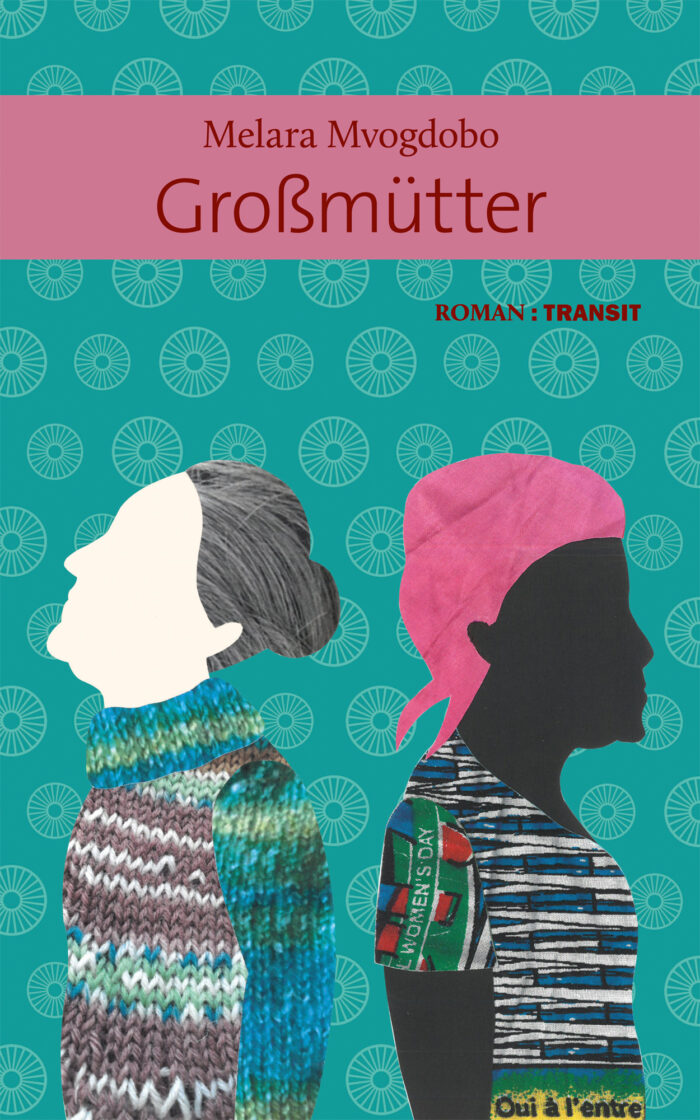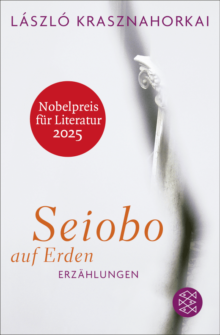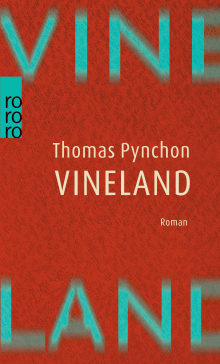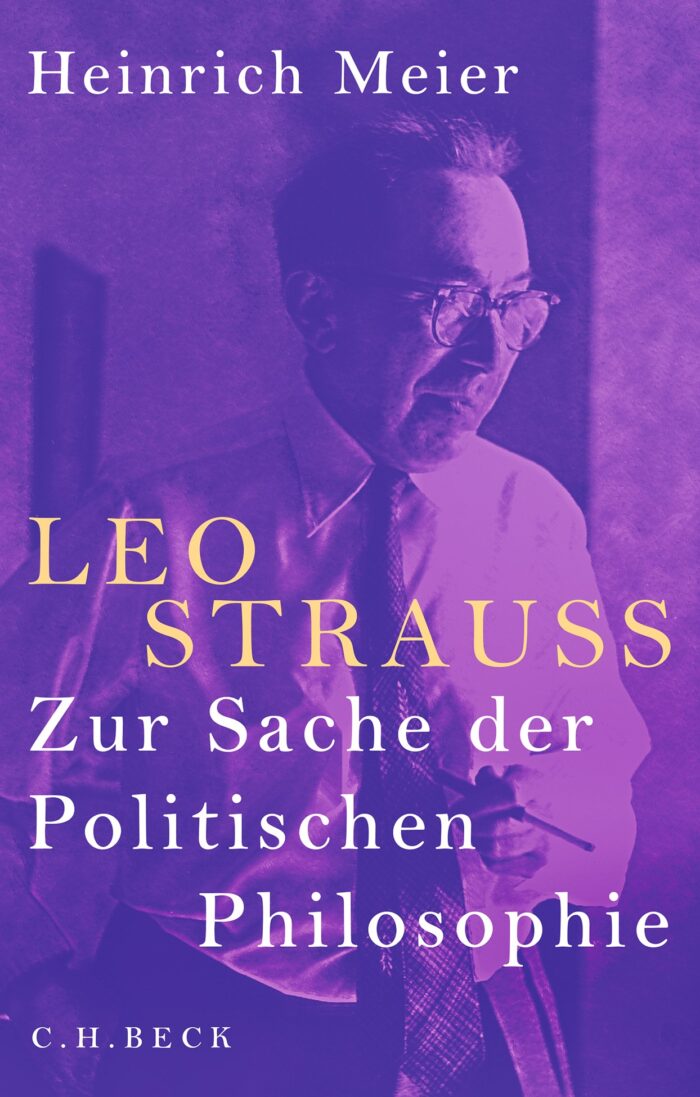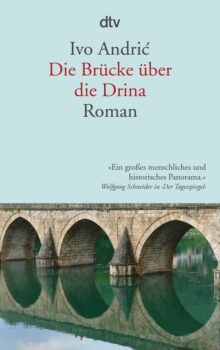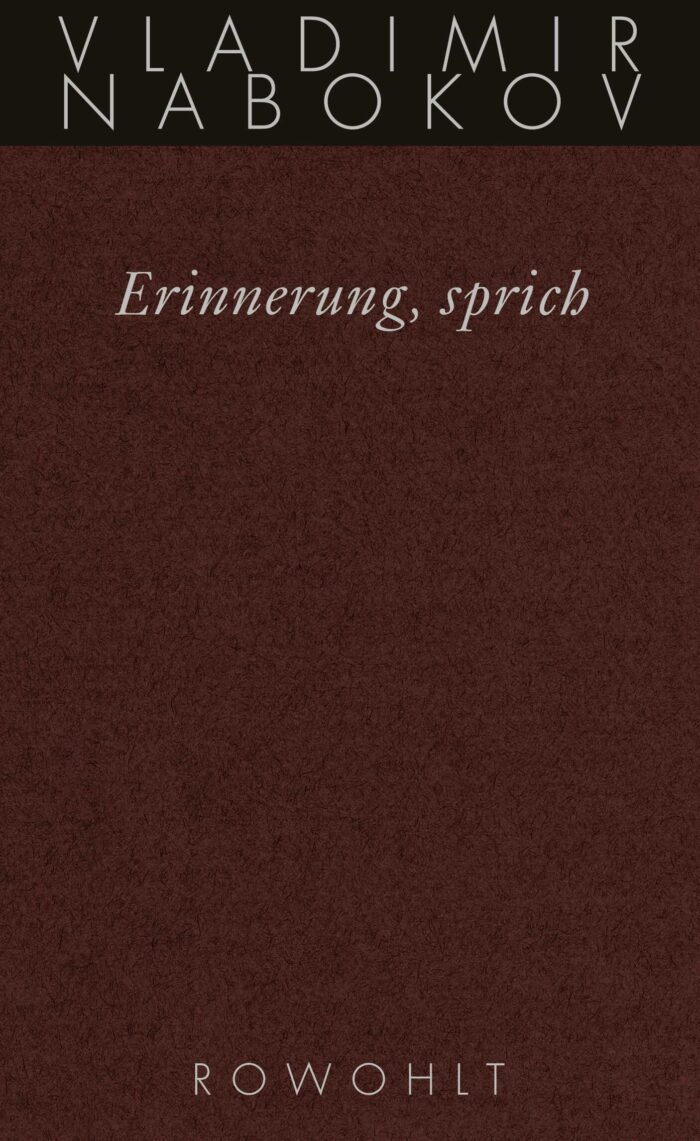Autor:
Friederike Mayröcker
Verlag: Suhrkamp
Genre: Belletristik
Erscheinungsjahr: 2008
Weitere bibliographische Angaben
ISBN: 978-3-518-41956-4
Einbandart: gebunden
Seitenzahl: 198
Sprache: Deutsch
MT
Moritz T.
Bewertungen
Besprechung
«Paloma» sind 99 durchnummerierte Briefe an einen «lieben Freund», verteilt über ein Jahr, vom Mai 2006 bis zum April 2007. Aber es ist kein Dialog, die Gegenbriefe des Freundes spielen eine marginale Rolle in den Texten. Viel eher ist es ein Tagebuch in Briefform.
Aber was für eines! Ein Tage- und Nachtbuch, ein Traumbuch, ein Buch der vielen Stimmen, die zitiert werden, und zwar gern so, dass die Quelle erst zum Ende eines (langen) Satzes hin genannt wird: nicht so wichtig, wer was sagt. Freunde kommen zu Wort, aus Büchern oder Briefen werden Passagen wiedergegeben, Traumstimmen. Die Zeiten und Bedeutungsebenen werden zuweilen in einem Satz gewechselt, mit grosser «Assoziationskraft», der der Leser nicht immer gewachsen ist, er bleibt zuweilen ratlos zurück. Es sei denn, er lässt sich von Klangfarben und Rhythmus über solche idiosynkratische Stellen hinwegtragen. Die Sprache ist über weite Strecken Silbe für Silbe durchgearbeitet, man erschrickt geradezu, wenn man einmal Standard-Versatzstücken begegnet.
Der Vergleich mit einem abstrakten Gemälde liegt nahe, wenn die Arbeit mit der Sprache als Material im Vordergrund steht, weniger die inhaltliche Kohärenz. Dennoch lässt sich eine ganze Anzahl von wiederkehrenden Motiven benennen, und einige dominante: Alter, Krankheit und drohende Demenz, Lektüren (Derrida und Nathalie Sarraute vor allem), Musik (sie hört gern Maria Callas, oder Duke Ellington). Von Blumen ist häufig die Rede, von Einsamkeit, von Erinnerungen an die Mutter, vor allem aber von Erinnerungen an IHN (stets in Grossbuchstaben), den verstorbenen Lebensgefährten Ernst Jandl. Begegnungen und Beobachtungen aus dem Alltag («das Fenster vis-à-vis») gehen nahtlos über in Traumerzählungen.
Es ist ein Buch von grosser Durchlässigkeit und Sinnlichkeit, das der Sprache Regionen erschliesst, in die sie sonst kaum vordringt.
«Und in der Nacht, wach liegend, hörte ich wie FEDER: federleicht ein Taschentuch auf den Boden neben dem Bett fiel.» Das Fallen des Taschentuchs in mehr als einem Sinn erfahren.
Keine einfache Lektüre, aber der Leser wird belohnt, wenn er in diesen Gedankenstrom eintaucht, der (hart erarbeitete) Spontaneität und Sprachsouveränität vereint. «(…) er wisse jetzt nämlich, warum ich eine ganz junge Anhängerschaft habe, weil aus meinen Wendungen oft die wilde Jähheit herausstrahlt, mit entspannt schlenkernden Armen (…).»
Mehr zeigen...
Aber was für eines! Ein Tage- und Nachtbuch, ein Traumbuch, ein Buch der vielen Stimmen, die zitiert werden, und zwar gern so, dass die Quelle erst zum Ende eines (langen) Satzes hin genannt wird: nicht so wichtig, wer was sagt. Freunde kommen zu Wort, aus Büchern oder Briefen werden Passagen wiedergegeben, Traumstimmen. Die Zeiten und Bedeutungsebenen werden zuweilen in einem Satz gewechselt, mit grosser «Assoziationskraft», der der Leser nicht immer gewachsen ist, er bleibt zuweilen ratlos zurück. Es sei denn, er lässt sich von Klangfarben und Rhythmus über solche idiosynkratische Stellen hinwegtragen. Die Sprache ist über weite Strecken Silbe für Silbe durchgearbeitet, man erschrickt geradezu, wenn man einmal Standard-Versatzstücken begegnet.
Der Vergleich mit einem abstrakten Gemälde liegt nahe, wenn die Arbeit mit der Sprache als Material im Vordergrund steht, weniger die inhaltliche Kohärenz. Dennoch lässt sich eine ganze Anzahl von wiederkehrenden Motiven benennen, und einige dominante: Alter, Krankheit und drohende Demenz, Lektüren (Derrida und Nathalie Sarraute vor allem), Musik (sie hört gern Maria Callas, oder Duke Ellington). Von Blumen ist häufig die Rede, von Einsamkeit, von Erinnerungen an die Mutter, vor allem aber von Erinnerungen an IHN (stets in Grossbuchstaben), den verstorbenen Lebensgefährten Ernst Jandl. Begegnungen und Beobachtungen aus dem Alltag («das Fenster vis-à-vis») gehen nahtlos über in Traumerzählungen.
Es ist ein Buch von grosser Durchlässigkeit und Sinnlichkeit, das der Sprache Regionen erschliesst, in die sie sonst kaum vordringt.
«Und in der Nacht, wach liegend, hörte ich wie FEDER: federleicht ein Taschentuch auf den Boden neben dem Bett fiel.» Das Fallen des Taschentuchs in mehr als einem Sinn erfahren.
Keine einfache Lektüre, aber der Leser wird belohnt, wenn er in diesen Gedankenstrom eintaucht, der (hart erarbeitete) Spontaneität und Sprachsouveränität vereint. «(…) er wisse jetzt nämlich, warum ich eine ganz junge Anhängerschaft habe, weil aus meinen Wendungen oft die wilde Jähheit herausstrahlt, mit entspannt schlenkernden Armen (…).»
Login
Bitte einloggen um zu kommentieren
0 Kommentare
Oldest