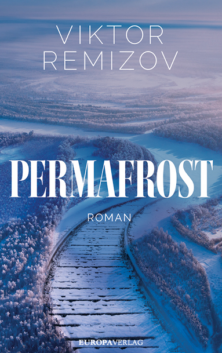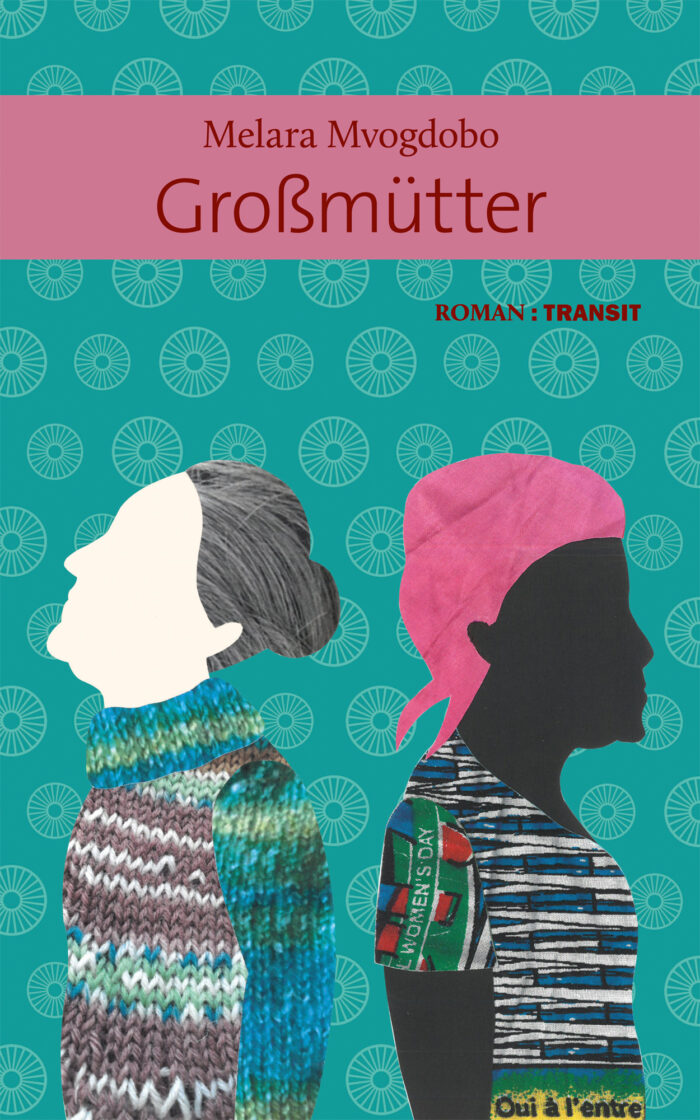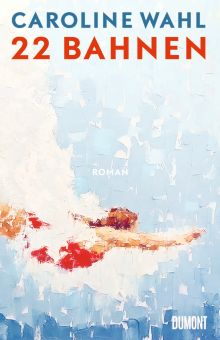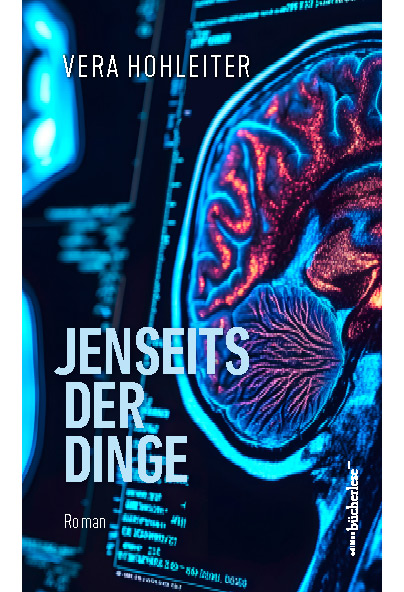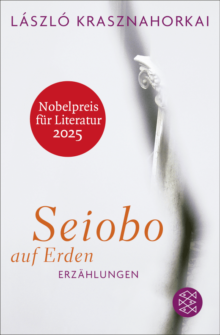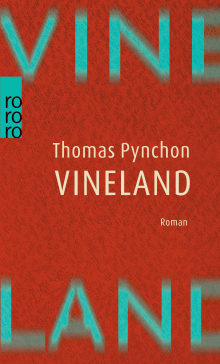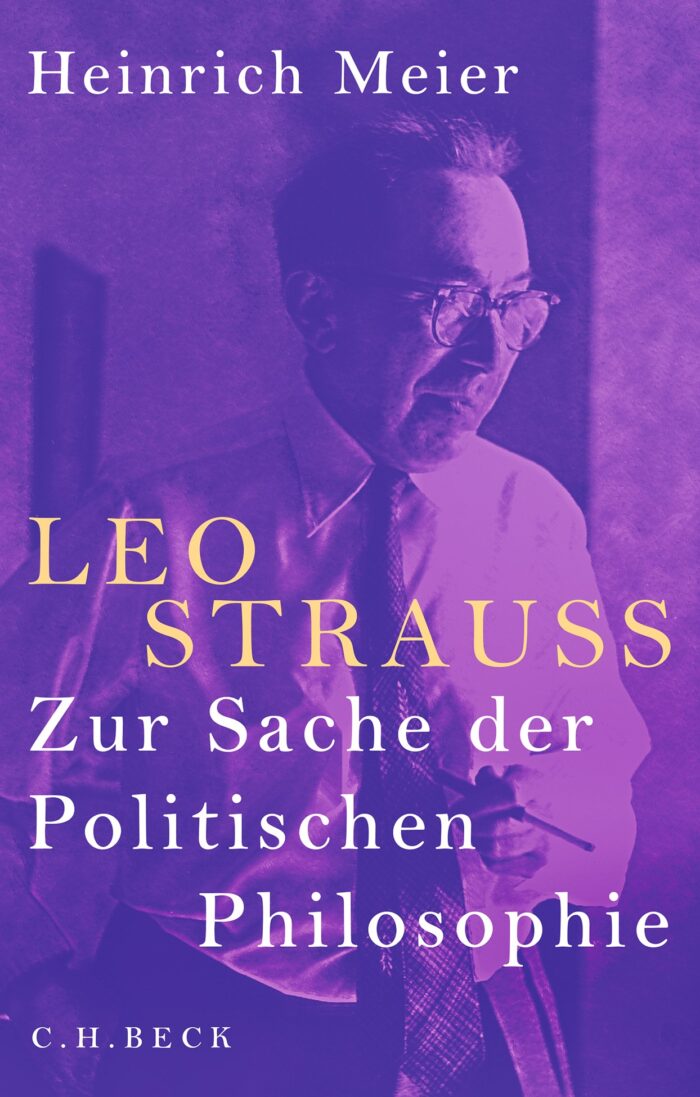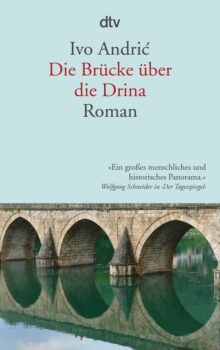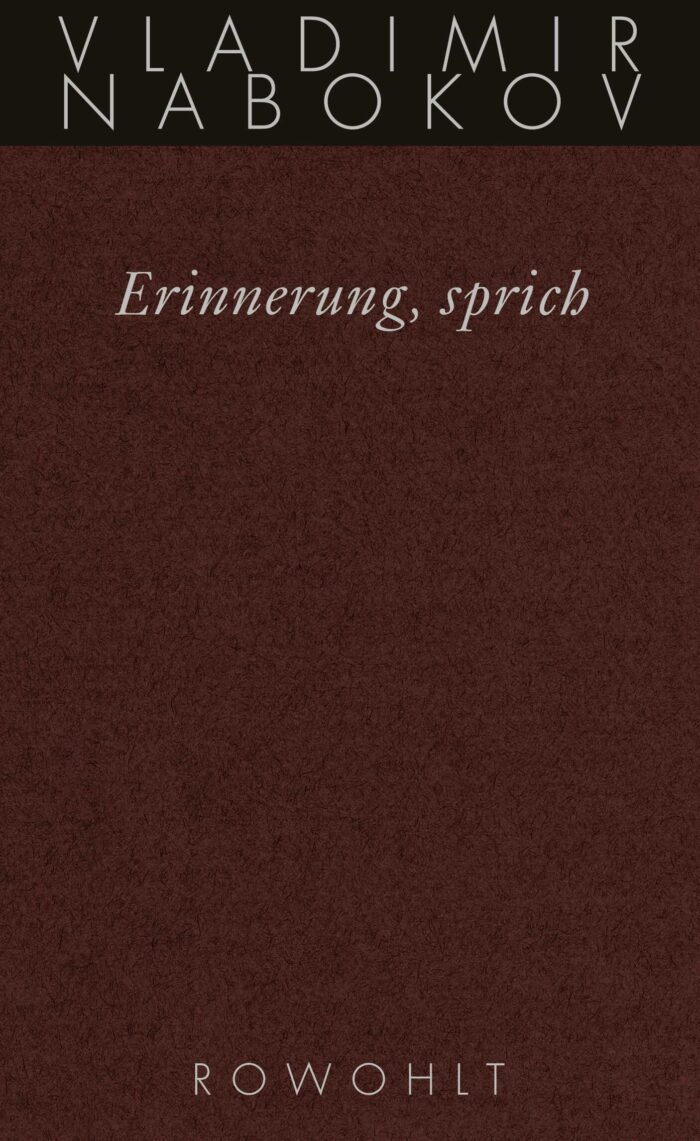Autor:
Viktor Remizov
Verlag: Europa Verlag
Genre: Belletristik
Erscheinungsjahr: 2025
Weitere bibliographische Angaben
ISBN: 978-3-95890-600-6
Einbandart: gebunden
Seitenzahl: 1264
Sprache: Deutsch
Originalsprache: russisch
Übersetzung: Franziska Zwerg
BH
Berthold H.
Bewertungen
Besprechung
„Permafrost“ ist ein Epos über den Bau der nie fertiggestellten „Stalinbahn“ der sibirischen Polarregion zwischen 1949 und 1953 (das Todesjahr Stalins). Dieses Vorhaben war nur eines der überdimensionalen Megaprojekte der Sowjetunion, etwa im Rahmen des „Grossen Stalinschen Plans zur Umgestaltung der Natur“, der auch die Verlegung der gewaltigen Ströme Ob und Jenissej vorsah.
Die klimatischen Bedingungen für den Bau der Trasse inmitten der Taiga, die zumeist oberhalb des nördlichen Polarkreises verlaufen sollte, waren überaus unwirtlich. Die Winter sind lang und kalt, die Temperaturen sinken bis unter -50 Grad, der gewaltige Jenissej ist von Oktober bis Juni zugefroren, die erforderlichen Ressourcen in Form von Baumaterial, Infrastruktur und Personal waren gigantisch. Heerscharen von Menschen wurden nach Sibirien deportiert, um in der Verbannung oder in Gefangenschaft den Bau der Eisenbahn zu ermöglichen. Die Fahrten der Lastkähne, mit denen tausende Verurteilte an die Baustellen herangeschafft wurden, waren strapaziös und riskant, weil noch weit bis in den Sommer hinein grosse Eisschollen oder sogenanntes Presseis die Passierbarkeit des Stroms stark eingeschränkt haben.
Der Roman beschreibt eindrücklich das unglaublich beschwerliche Leben in den neu geschaffenen Siedlungen und in den Lagern. Die Hauptfiguren sind der Lagerhäftling Gortschakow, der ein anerkannter Geologe war und als Entdecker grosser Rohstoffvorkommen in Nordsibirien gilt und überdies ein begabter Klavierspieler ist, und der junge Kapitän Below, der mit seinem Schlepper „Poljarny“ unzählige Lastkähne zieht, oftmals mehrere hintereinander. Im Gegensatz zu Gortschakow, der als „58er“ geführt wird – jemand, der nach dem Paragraphen 58 für Verbrechen gegen den sozialistischen Staat verurteilt wurde –, und noch über 20 Jahre Lagerleben vor sich hat, ist Kapitän Below ein „Freier“. Er hat sich der Schifffahrt verschrieben, ist zupackend, engagiert und idealistisch, glaubt fest an den sowjetischen Staat und will seinen Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft leisten. Er hat grosses Vertrauen in die Führungsriege und verehrt insbesondere den obersten Führer, den Generalissimus Jossif Wissarionowitsch Stalin. Mangelnde Ehrerbietung gegenüber der Führung ist für ihn schwer hinnehmbar.
Die Erzählstimme übernimmt oftmals die Perspektiven von Gortschakow und Below oder von Personen, die ihnen nahestehen, etwa von Asja, der Ehefrau von Gortschakow, die sich mit den gemeinsamen Kindern Kolja und Sewa im entfernten Moskau mehr schlecht als recht durchschlägt, schon lange nichts mehr vom Ehemann gehört hat und zunehmend verzweifelt.
Der Autor dringt tief in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten ein, durch gelegentliche Rückblenden auf den Werdegang der Figuren erschliesst sich dem Leser ein immer detaillierteres Bild. Wir erfahren gleichsam aus erster Hand, was in den Menschen vorgeht, sie antreibt, wie sie emotional hin- und hergerissen werden, hadern, sich arrangieren, abstumpfen und schlicht überleben.
Überdies erhält man Einblick in das Innenleben der Sowjetgesellschaft - in die Ideale, die gesellschaftlichen Strukturen, die politischen Gremien, die bürokratischen Prozesse, den administrativen Wahnsinn, den überbordenden Sicherheitsapparat, die Hierarchien, der Willkürherrschaft, den Kompetenzwirrwarr, das Eigenleben von Behörden – und es wird auf subtile Art verständlich, was dieses System mit den Menschen macht und wie sie darin leben, und sterben. Der Ton ist nüchtern, die Sprache klar, die Erzählung in der Geschichte verankert. Es werden immer wieder historische Figuren benannt oder aus offiziellen Texten, etwa aus dem Politbüro oder dem Zentralkomitee, zitiert.
Auf jeder Seite des Buches hat man es unverkennbar mit Russland zu tun: sei es aufgrund der Namen und Vatersnamen und deren zahlreichen Koseformen (Kapitän Below etwa heisst mit Vornamen Alexander Alexandrowitsch oder einfach Sascha oder San Sanytsch oder auch Sanetschka), der ausgeprägten Trinkkultur (meist mit „Sprit“, verdünntem Alkohol), dem Papirossa-Rauchen oder der Kleidung in Form von Wattejacken, Fusslappen, Filzstiefeln oder Mützen mit Ohrenklappen. Leser machen Bekanntschaft mit Begriffen aus der russischen Sprache, etwa Natschalnik (Vorgesetzter) oder Seki (Strafgefangene), und speziellen Codes (z.B. bedeutet „am Fliessband stehen“ tagelange Verhöre, bei denen sich die Ermittler abwechseln und die Arrestierten vom Schlafen abgehalten werden).
Der Roman bietet mitunter schwere Kost. Es gibt Szenen, die unter die Haut gehen, und man mag sich fragen, wie es zu den vielen Grausamkeiten und Vermessenheiten kommen konnte. In jedem Fall bietet „Permafrost“ eine lohnenswerte Lektüre. Der Roman wurde 2021 in Russland zum „Buch des Jahres“ gekürt und war ein Bestseller. Er wirkt gründlich recherchiert, er ist gut lesbar, er zieht einen auf jeder seiner 1250 Seiten in den Bann, und er vermittelt einen interessanten Einblick in einen Teil der sowjetischen Geschichte.
Mehr zeigen...
Die klimatischen Bedingungen für den Bau der Trasse inmitten der Taiga, die zumeist oberhalb des nördlichen Polarkreises verlaufen sollte, waren überaus unwirtlich. Die Winter sind lang und kalt, die Temperaturen sinken bis unter -50 Grad, der gewaltige Jenissej ist von Oktober bis Juni zugefroren, die erforderlichen Ressourcen in Form von Baumaterial, Infrastruktur und Personal waren gigantisch. Heerscharen von Menschen wurden nach Sibirien deportiert, um in der Verbannung oder in Gefangenschaft den Bau der Eisenbahn zu ermöglichen. Die Fahrten der Lastkähne, mit denen tausende Verurteilte an die Baustellen herangeschafft wurden, waren strapaziös und riskant, weil noch weit bis in den Sommer hinein grosse Eisschollen oder sogenanntes Presseis die Passierbarkeit des Stroms stark eingeschränkt haben.
Der Roman beschreibt eindrücklich das unglaublich beschwerliche Leben in den neu geschaffenen Siedlungen und in den Lagern. Die Hauptfiguren sind der Lagerhäftling Gortschakow, der ein anerkannter Geologe war und als Entdecker grosser Rohstoffvorkommen in Nordsibirien gilt und überdies ein begabter Klavierspieler ist, und der junge Kapitän Below, der mit seinem Schlepper „Poljarny“ unzählige Lastkähne zieht, oftmals mehrere hintereinander. Im Gegensatz zu Gortschakow, der als „58er“ geführt wird – jemand, der nach dem Paragraphen 58 für Verbrechen gegen den sozialistischen Staat verurteilt wurde –, und noch über 20 Jahre Lagerleben vor sich hat, ist Kapitän Below ein „Freier“. Er hat sich der Schifffahrt verschrieben, ist zupackend, engagiert und idealistisch, glaubt fest an den sowjetischen Staat und will seinen Beitrag zum Aufbau der sozialistischen Gesellschaft leisten. Er hat grosses Vertrauen in die Führungsriege und verehrt insbesondere den obersten Führer, den Generalissimus Jossif Wissarionowitsch Stalin. Mangelnde Ehrerbietung gegenüber der Führung ist für ihn schwer hinnehmbar.
Die Erzählstimme übernimmt oftmals die Perspektiven von Gortschakow und Below oder von Personen, die ihnen nahestehen, etwa von Asja, der Ehefrau von Gortschakow, die sich mit den gemeinsamen Kindern Kolja und Sewa im entfernten Moskau mehr schlecht als recht durchschlägt, schon lange nichts mehr vom Ehemann gehört hat und zunehmend verzweifelt.
Der Autor dringt tief in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten ein, durch gelegentliche Rückblenden auf den Werdegang der Figuren erschliesst sich dem Leser ein immer detaillierteres Bild. Wir erfahren gleichsam aus erster Hand, was in den Menschen vorgeht, sie antreibt, wie sie emotional hin- und hergerissen werden, hadern, sich arrangieren, abstumpfen und schlicht überleben.
Überdies erhält man Einblick in das Innenleben der Sowjetgesellschaft - in die Ideale, die gesellschaftlichen Strukturen, die politischen Gremien, die bürokratischen Prozesse, den administrativen Wahnsinn, den überbordenden Sicherheitsapparat, die Hierarchien, der Willkürherrschaft, den Kompetenzwirrwarr, das Eigenleben von Behörden – und es wird auf subtile Art verständlich, was dieses System mit den Menschen macht und wie sie darin leben, und sterben. Der Ton ist nüchtern, die Sprache klar, die Erzählung in der Geschichte verankert. Es werden immer wieder historische Figuren benannt oder aus offiziellen Texten, etwa aus dem Politbüro oder dem Zentralkomitee, zitiert.
Auf jeder Seite des Buches hat man es unverkennbar mit Russland zu tun: sei es aufgrund der Namen und Vatersnamen und deren zahlreichen Koseformen (Kapitän Below etwa heisst mit Vornamen Alexander Alexandrowitsch oder einfach Sascha oder San Sanytsch oder auch Sanetschka), der ausgeprägten Trinkkultur (meist mit „Sprit“, verdünntem Alkohol), dem Papirossa-Rauchen oder der Kleidung in Form von Wattejacken, Fusslappen, Filzstiefeln oder Mützen mit Ohrenklappen. Leser machen Bekanntschaft mit Begriffen aus der russischen Sprache, etwa Natschalnik (Vorgesetzter) oder Seki (Strafgefangene), und speziellen Codes (z.B. bedeutet „am Fliessband stehen“ tagelange Verhöre, bei denen sich die Ermittler abwechseln und die Arrestierten vom Schlafen abgehalten werden).
Der Roman bietet mitunter schwere Kost. Es gibt Szenen, die unter die Haut gehen, und man mag sich fragen, wie es zu den vielen Grausamkeiten und Vermessenheiten kommen konnte. In jedem Fall bietet „Permafrost“ eine lohnenswerte Lektüre. Der Roman wurde 2021 in Russland zum „Buch des Jahres“ gekürt und war ein Bestseller. Er wirkt gründlich recherchiert, er ist gut lesbar, er zieht einen auf jeder seiner 1250 Seiten in den Bann, und er vermittelt einen interessanten Einblick in einen Teil der sowjetischen Geschichte.
Login
Bitte einloggen um zu kommentieren
0 Kommentare
Oldest